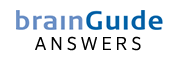Anfang und Ende beim Wettbewerbsverbot für Geschäftsführer der GmbH
Beitrag, Deutsch, 10 Seiten, zumAnwalt.de
Immer wieder tauchen Missverständnisse und Fehleinschätzungen im Zusammenhang mit der Frage nach den rechtlichen Spielräumen insbesondere für nachvertragliche Wettbe-werbsverbote bei GmbH-Geschäftsführern auf – um so mehr, wenn es um das Thema der Karenzentschädigung und eines diesbezüglichen Verzichts bzw. einer evtl. diesbezüglichen Lossagung geht.
A. Abgrenzungen:
I. Vertragliches Wettbewerbsverbot für Geschäftsführer
Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot für GmbH-Geschäftsführer ist zunächst zu un-terscheiden von dem vertraglichen Wettbewerbsverbot des GmbH-Geschäftsführers. Das vertragliche Wettbewerbsverbot (also das Wettbewerbsverbot, das während der Dauer der Anstellung gilt) besteht auch ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung bereits nach dem Gesetz – und zwar für alle Tätigkeiten des Geschäftsführers innerhalb des sich nach dem Satzungszweck der GmbH bestimmenden Geschäftsgebietes der GmbH, egal ob der Geschäftsführer im eigenen oder im fremden Namen, für eigene oder auf fremde Rechnung, ob er als Kommissionär, Handelsvertreter, Handelsmakler, Einzelkaufmann oder im Rahmen einer anderen GmbH tätig ist oder auch nur an einem Konkurrenzunter-nehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.
II. Wettbewerbsverbote für Gesellschafter
Ferner ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot für GmbH-Geschäftsführer abzu-grenzen von vertraglichen und/oder nachvertraglichen Wettbewerbsverboten für GmbH-Gesellschafter.
Bei den meisten, eher personalistisch strukturierten GmbHs wird von der Rechtspre-chung für beherrschende Gesellschafter bzw. Gesellschafter, die maßgeblichen Einfluss auf den oder die Geschäftsführer ausüben können, ein gesetzlich geltendes Wettbe-werbsverbot während der Gesellschaftszugehörigkeit bejaht. Dies gilt nicht für Minder-heitsgesellschafter – und nach aktuellerer Rechtsprechung des BGH auch nicht für Ge-sellschafter-Geschäftsführer einer Ein-Personen-GmbH.
Dem gegenüber gibt es – außer im Falle vertraglicher Vereinbarung – kein bereits ge-setzlich bestehendes nachvertragliches Wettbewerbsverbot für Gesellschafter einer Gmbh.
III. Arbeitnehmerschutz
Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass GmbH-Geschäftsführer gemäß der ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung des § 5 Abs. 1 S. 3 ArbGG keine Arbeitnehmer im Sinne der Arbeitsgerichtsbarkeit sind. Für diese Ge-schäftsführer gilt gem. § 14 Abs. 1 Ziff. 1. KSchG bekanntlich auch nicht der für Arbeit-nehmer geltendes Kündigungsschutz.
Für etwaige prozessuale Streitigkeiten zwischen GmbH und GmbH-Geschäftsführer sind deshalb die Zivilgerichte (erstinstanzlich die Amtsgerichte bzw. Landgerichte) zuständig – beim Landgericht regelmäßig nach dem GVG die KfH.
Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn ein früherer Arbeitnehmer der GmbH zum Geschäftsführer bestellt wird und während dieser Zeit das vormalige Arbeits-verhältnis lediglich ruht und nicht endgültig beendet wird, so dass es nach etwaiger Be-endigung der Geschäftsführer-Stellung wieder aufleben könnte. Dann könnten nach Be-endigung der Geschäftsführer-Stellung Streitigkeiten hinsichtlich des ggf. fortbestehen-den Arbeitsverhältnisses zwischen dem Mitarbeiter und der Gesellschaft vor dem Ar-beitsgericht ausgetragen werden.
Für die hier schwerpunktmäßig zu behandelnde Thematik bleibt grundsätzlich festzuhalten, dass GmbH-Geschäftsführer keine Arbeitnehmer im Rechtssinne sind und deshalb nach h. M. auch eine geringere soziale Schutzwürdigkeit genießen. Bei GmbH-Geschäftsführern geht die Rechtsprechung regelmäßig von einer gegenüber Arbeitnehmern besseren allge-meinen wirtschaftlichen Absicherung aus; hinzu kommt, dass GmbH-Geschäftsführer prak-tisch selbst in der GmbH die Arbeitgeberposition einnehmen und auch deshalb bei der ana-logen Anwendung von gesetzlichen Schutzvorschriften zugunsten von abhängig Beschäftig-ten Zurückhaltung geboten ist.
IV. Verschwiegenheitspflicht
Zu unterscheiden von einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot für GmbH-Geschäftsführer ist die auch ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung dem GmbH-Geschäftsführer auch nach seinem Ausscheiden obliegende Verschwiegenheitsverpflich-tung.
Gem. § 85 GmbHG wird mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer ein Geheimnis der GmbH, insbesondere ein Betriebs- oder Geschäftsge-heimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer bekannt geworden ist, unbe-fugt offenbart. In qualifizierten Fällen kann sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jah-ren ausgeurteilt werden.
Die sich insoweit manifestierende nachvertragliche Treuepflicht des GmbH-Geschäftsführers umfasst neben der Geheimhaltungsverpflichtung allerdings grundsätz-lich kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot; lediglich in besonderen Ausnahmefällen kann sich die nachvertragliche Treuepflicht praktisch als ein nachvertragliches Wettbe-werbsverbot darstellen, wenn einem ehemaligen GmbH-Geschäftsführer beispielsweise zu verbieten ist, Geschäftschancen, die er eigentlich in der Funktion und während der Zeit seiner Geschäftsführertätigkeit hätte nutzen können und müssen, hinterher treuwid-rig zum eigenen Vorteil oder zugunsten Dritter zu verwerten oder auch zuvor als GmbH-Geschäftsführer abgeschlossene Verträger hinterher auf eigene oder dritte Rechnung quasi an sich zu ziehen bzw. auszubeuten.
B. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot für Geschäftsführer:
Die oben dargestellten Abgrenzungen sind von Bedeutung für das Verständnis der nach-folgend beschriebenen Aspekte zur Zulässigkeit, zur Form und zu den inhaltlichen Gren-zen eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes für GmbH-Geschäftsführer sowie zur Karenzentschädigung samt diesbezüglichem Verzicht bzw. diesbezüglicher Lossagung:
I. Form der Wettbewerbsvereinbarung
Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot eines GmbH-Geschäftsführers bedarf also grundsätzlich einer ausdrücklichen – oder zumindest plausibilisierbaren schlüssigen – Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer. Diese Vereinbarung bedarf zwar grundsätzlich nicht der Schriftform; dennoch ist allerdings – schon zur Vermeidung von Missverständnissen, zur Fixierung kom-plexerer Regelungen und zu Beweiszwecken – eine schriftliche Fixierung des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes bzw. eine ausdrückliche Aufnahme die-ses nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes in den Geschäftsführer-Anstellungsvertrag zweckmäßig und sinnvoll.
II. Inhaltliche Grenzen
Die inhaltlichen Grenzen des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes hinsichtlich des GmbH-Geschäftsführers bestimmen sich – anders als bei Handlungsgehilfen – nicht unmittelbar gem. § 74 a HGB; die dortigen Grundgedanken werden von der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung allerdings im Er-gebnis über die zivilrechtliche Generalklausel des § 138 BGB in entsprechender bzw. ähnlicher Weise angewendet:
1. Zweckrichtung
Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot darf ausschließlich mit der Zweckrichtung vereinbart werden, die GmbH in einem berechtigten ge-schäftlichen Interesse insbesondere vor unloyaler Verwertung der der Gesellschaft zustehenden Arbeitsergebnisse und vor missbräuchlicher Ausnutzung der grundsätzlich gem. Art. 12 Grundgesetz bestehenden Freiheit der Berufsausübung zu schützen. Hierbei reicht nicht der Wunsch der Gesellschaft, eine kompetente und versierte Kraft für Wett-bewerber zu blockieren; von der obergerichtlichen und höchstrichterli-chen Rechtsprechung wird aber beispielsweise ein berechtigtes ge-schäftliches Interesse der GmbH dann bejaht, wenn der Schutz be-stimmter Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und bei der GmbH auf-gebauter Kunden- und/oder Lieferantenstämme bezweckt wird.
2. Bewertungszeitpunkt
In der Rechtsprechung ist umstritten, auf welchen Zeitpunkt bei der Be-wertung der Interessengerechtigkeit des nachvertraglichen Wettbe-werbsverbotes abzustellen ist, auf den Zeitpunkt der vertraglichen Ver-einbarung, oder auf den Zeitpunkt des Ausscheidens des Geschäftsfüh-rers. Eine gerichtsfeste Aussage ist hierzu bei dem aktuellen Stand der Rechtsprechung nicht möglich. Zu empfehlen ist, eine Vereinbarung zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot nach längerem Zeitablauf auf die Frage immer noch gültiger und interessengerechter Ausgestaltung zu prüfen und im Zweifelsfall ggf. entsprechend einverständlich zu ak-tualisieren – ähnlich wie sich dies auch bei gesellschaftsvertraglichen Abfindungsklauseln nach der aktuellen BGH-Rechtsprechung empfiehlt.
3. Umfang des Wettbewerbsverbots
Soweit ein ausreichendes berechtigtes Interesse der GmbH hinsichtlich eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes zulasten des GmbH-Geschäftsführers besteht, bleibt in einer zweiten Stufe zu prüfen, welchen sachlichen, örtlichen und zeitlichen Umfang das nachvertragliche Wettbewerbsverbot haben soll bzw. im konkreten Fall jeweils haben darf.
Örtlich und zeitlich unbegrenzte Wettbewerbsverbote sind – bis auf ganz exotische Ausnahmefälle – nach ständiger obergerichtlicher und höchst-richterlicher Rechtsprechung rechtlich unwirksam.
Branchen, in denen die GmbH nicht tätig ist und in der sich insofern kei-ne Wettbewerbssituation zulasten der GmbH ergibt, können einem aus-geschiedenen Geschäftsführer selbstverständlich nicht verwehrt werden. Bei sehr spezialisiertem Geschäftsfeld der GmbH ist ggf. sogar ein Wettbewerbsverbot für mehrere Länder rechtlich zulässig; bei weniger spezialisierten Unternehmen wird ein örtlich zu weit gefasstes vertragli-ches Wettbewerbsverbot eher bedenklich sein.
Hinsichtlich der zeitlichen Grenzen hat sich in der Rechtsprechung die Zweijahresfrist der eigentlich nicht unmittelbar anwendbaren gesetzli-chen Vorschrift des § 74 a HGB manifestiert als grundsätzlich anzule-gender Zeitrahmen.
Es bleibt der GmbH selbstverständlich unbenommen, kürzere Fristen vertraglich festzulegen.
4. Karenzentschädigung
Anders, als dies häufig vermutet wird, ist die Wirksamkeit der Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes für GmbH-Geschäftsführer nicht von der gleichzeitigen Zusage einer Karenzentschädigung abhängig, anders als dies gem. 74 Abs. 2 HGB für Handlungsgehilfen bzw. Arbeitnehmer der Fall ist. Es ist in dem Zusammenhang nach herrschender Meinung gleichgültig, ob der GmbH-Geschäftsführer Minderheits- oder Mehrheitsgesellschafter oder auch nur Fremd-geschäftsführer ist.
a) Bedingungen
Wegen der in diesem Zusammenhang bestehenden grundsätzlichen Vertragsfreiheit ist auch daran zu denken, die Karenzentschädigung o-der auch die Höhe der Karenzentschädigung von klaren, nicht lediglich vom Willen der GmbH-Gesellschafter abhängigen Bedingungen abhän-gig zu machen. Hier kommen in Betracht etwa die Dauer der Unterneh-menszugehörigkeit, das Erreichen bzw. das Überschreiten bestimmter Altersgrenzen, die Erreichung oder der Verlust spezifischer Ergebnisse und/oder Kompetenzen u. ä.
Die obergerichtliche Rechtsprechung ist diesbezüglich allerdings durch-aus uneinheitlich und in der Entwicklung begriffen und weicht gelegent-lich von der herrschenden Meinung und der höchstrichterlichen Recht-sprechung des BGH ab.
b) Höhe
Dies gilt auch hinsichtlich der Frage der Höhe der Karenzentschädigung, bei der beispielsweise das OLG Düsseldorf eine analoge Anwendung der gesetzlichen Halbierungsregel des § 74 Abs. 2 HGB befürwortet (entgegen BGH-Rechtsprechung). Diese widersprüchliche Rechtspre-chungssituation macht eine gerichtsfeste Vertragsgestaltung selbstver-ständlich nicht leichter.
Zu empfehlen ist ggf. zumindest eine entsprechende Anwendung der für Handelsvertreter geltenden gesetzlichen Vorschrift des § 90 a Abs. 1 S. 3 HGB; diese Regelung billigt dem Handelsvertreter für die Dauer der Wettbewerbsbeschränkung „eine angemessene Entschädigung“ zu.
c) Anrechnung, Vertragsstrafen
Wegen uneinheitlicher Rechtsprechung auch zur Frage, ob während der Dauer eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes vom ehemaligen Geschäftsführer erzielter anderweitiger Erwerb auch ohne ausdrückliche Vereinbarung auf eine etwaige Karenzentschädigung anrechenbar ist oder nicht (in etwaiger analoger Anwendung von § 74 c HGB), empfiehlt sich diesbezüglich eine eindeutige Festlegung in den Geschäftsführer-Anstellungsverträgen.
Entsprechendes gilt für etwaige Vertragsstrafen u. ä.
5. Verzicht
Vor Beendigung des Dienstverhältnisses ist gem. § 75 a HGB ein Verzicht des Prinzipals hinsichtlich des Wettbewerbsverbotes in schriftlicher Form mit der Wir-kung möglich und zulässig, dass er mit dem Ablauf eines Jahres nach der Ver-zichtserklärung von der Verpflichtung zur Zahlung einer vereinbarten Karenzent-schädigung frei wird. Die rechtlichen Grundgedanken dieser gesetzlichen Rege-lung können nach der herrschenden Rechtsprechung und Literatur auch zuguns-ten der GmbH im Verhältnis zum GmbH-Geschäftsführer angewendet werden.
Ob die Anwendung auch hinsichtlich der mindestens einjährigen Pflicht zur Ka-renzentschädigungs-Zahlung gilt, ist in der Rechtsprechung nicht unumstritten. Zumindest für den Fall, dass die GmbH den Verzicht erst kurz vor einer Vertrags-beendigung erklärt und damit zu einem Zeitpunkt, in dem sich der GmbH-Geschäftsführer ggf. bereits auf seine durch das Wettbewerbsverbot einge-schränkten beruflichen Möglichkeiten und Orientierungen eingestellt hat, bejaht der BGH eine fortgeltende Zahlungspflicht.
Die Gerichte werden – soweit nichts anderes vereinbart ist regelmäßig längstens für die Dauer eines Jahres – den entschädigungspflichtigen Zeitraum für den Fall der Verzichtserklärung durch die GmbH umso länger bemessen, je später der Verzicht durch die GmbH gegenüber dem GmbH-Geschäftsführer erklärt worden ist bzw. je kürzer der Zeitraum zwischen Verzichtserklärung und Vertragsbeendi-gung ist.
Auch im Zusammenhang mit dieser Thematik empfiehlt sich eine möglichst ge-richtsfeste vertragliche Fixierung, wobei m. E. dann, wenn bereits im Vertrag Ver-zichtsmöglichkeiten der GmbH festgelegt werden, das Argument der berücksich-tungswürdigen Dispositionsfreiheit des GmbH-Geschäftsführers nicht mehr so stark zugunsten des Geschäftsführers und zulasten der GmbH wirken kann.
Zu der Frage, ob nach Vertragsbeendigung ein Verzicht auf die Wettbewerbsab-rede durch die GmbH zulässig ist, liegt bisher keine abschließende höchstrichter-liche Rechtsprechung vor. Ein Teil der Instanzen-Rechtsprechung und ein Teil der Literatur bejaht dies allerdings m. E. zu Recht, und zwar unter Berücksichtigung der vom Geschäftsführer regelmäßig wahrgenommenen Arbeitgeberrolle und sei-ner gegenüber herkömmlichen Arbeitnehmern geringeren wirtschaftlichen und sozialen Absicherungs- und Schutzbedürftigkeit. Auch in diesem Zusammenhang ist allerdings eine ausdrückliche vertragliche Klarstellung zu empfehlen..
Hinsichtlich der Frage der (ggf. wie lange) fortdauernden Pflicht zur Zah-lung der Karenzentschädigung ist auf die obigen Ausführungen zu ver-weisen.
6. Lossagung nach Kündigung des Dienstvertrages
Eine zusätzlich klärungsbedürftige Fallgestaltung ergibt sich, wenn die GmbH bzw. deren Geschäftsführer den Geschäftsführer-Anstellungsvertrag ordentlich oder außerordentlich kündigt und verbunden damit oder im Anschluss daran die Gesellschaft oder der Geschäftsführer sich von dem Wettbewerbsverbot lossa-gen, sich daran also nicht mehr gebunden fühlen wollen.
Kündigt der Geschäftsführer zu Recht außerordentlich und aus wichti-gem, von der GmbH zu vertretenden Gründen den Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, so ist der GmbH-Geschäftsführer nach überwiegen-der Rechtsauffassung in analoger Anwendung von § 75 Abs. 1 HGB be-rechtigt, sich vor Ablauf eines Monats nach der außerordentlichen Kün-digung von dem vereinbarten Wettbewerbsverbot loszusagen.
Entsprechend kann auch die Gesellschaft dann, wenn sie aus vom Ge-schäftsführer zu vertretenden Gründen den Anstellungsvertrag außeror-dentlich fristlos berechtigterweise kündigt, sich durch schriftliche Erklä-rung innerhalb eines Monats nach dem Zugang der Kündigungserklä-rung von einem vertraglich vereinbarten nachvertraglichen Wettbe-werbsverbot gegenüber dem GmbH-Geschäftsführer lossagen.
Diese Lossagungen gehen selbstverständlich einher mit dem entspre-chenden Untergang einer ggf. vereinbarten Karenzentschädigungs-pflicht.
Ein über die obigen Hinweise zum Verzichtsrecht hinausgehendes ge-setzliches Lossagungsrecht der GmbH bzw. des Geschäftsführers für den Fall der von der einen oder anderen Seite erklärten ordentlichen Kündigung des Anstellungsverhältnisses – u. a. etwa in analoger An-wendung von § 75 Abs. 2 HGB – wird von der überwiegenden Literatur – m. E. zu Recht – verneint. Etwas anderes kann ggf. bei ausdrücklicher einverständlicher vertraglicher Festlegung gelten.
7. Kündigung der Wettbewerbsvereinbarung
Von der Frage des Verzichtes auf die Wettbewerbsvereinbarung bzw. einer Los-sagung von der Wettbewerbsvereinbarung zu trennen ist die Frage der Kündi-gung der nachvertraglichen Wettbewerbsvereinbarung.
Hier ist zum einen daran zu denken, in die Vereinbarung des Wettbe-werbsverbotes ggf. bestimmte ordentliche Kündigungsfristen „einzubau-en“ oder auch bereits bestimmte Fallbeispiele für außerordentliche Kün-digungsgründe aufzulisten. Unabhängig davon besteht – wie bei allen Dauerschuldverhältnissen – ein außerordentliches Kündigungsrecht hin-sichtlich der Wettbewerbsvereinbarung dann, wenn wichtige Gründe zu-gunsten der einen und zulasten der anderen Seite vorliegen. Dies kön-nen etwa sein grobe Verstöße gegen das Wettbewerbsverbot auf der ei-nen Seite oder auch längerer Verzug mit Karenzentschädigungszahlun-gen auf der anderen Seite.
8. Verstoßfolgen
Bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstößen des GmbH-Geschäftsführers ge-gen ein vertraglich vereinbartes (nachvertragliches) Wettbewerbsverbot bleiben neben der eben angesprochenen außerordentlichen Kündigungsmöglichkeit der GmbH selbstverständlich die Rechte auf Unterlassung (geltend zu machen ggf. im Wege einer Abmahnung, gerichtet auf Abgabe einer strafbewehrten Unterlas-sungserklärung), auf Schadensersatz und ggf. – für den Fall entsprechender ver-traglicher Vereinbarung – auf Zahlung von Vertragsstrafen für schuldhafte Ver-stöße des (ehemaligen) GmbH-Geschäftsführers.
Dr. Ralf Petring
Rechtsanwalt
Bielefeld
Fachthemen
DE, Bielefeld
DR. WEND & PARTNER GbR Rechtsanwälte und Steuerberater
Publikationen: 5
Aufrufe seit 10/2004: 3964
Aufrufe letzte 30 Tage: 1