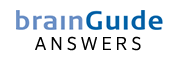PDM im Mittelstand - Eine grundlegende Betrachtung
Interview, Deutsch, 3 Seiten, Dressler Verlag e.K.
Autor: Dr. Roland Drewinski
Erscheinungsdatum: 01.06.2006
Seitenangabe: 34-36
Aufrufe gesamt: 1752, letzte 30 Tage: 1
Kontakt
Verlag
Telefon: +49-6221-9113-0
Telefax: +49-6221-9113-21
Preis: Kostenlos
PDM im Mittelstand – eine grundlegende Betrachtung
Analysten gehen davon aus, dass der Mittelstand in den nächsten 12 bis 24 Monaten verstärkt in moderne IT-Lösungen investieren wird. Eine zentrale Rolle sollten dabei insbesondere auch PDM-Produkte spielen.
In einem Gespräch mit der Redaktion des eDM-REPORT erläutert der PDM-Experte Dr.-Ing. Roland Drewinski, der 5 Jahre den Geschäftsbereich Kundenprojekte bei Contact Software geleitet hat, die Gründe.
Herr Dr. Drewinski, welche Zeichen deuten darauf hin, dass ein Unternehmen an der Einführung eines modernen PDM-Produktes nicht mehr vorbeikommt?
Roland Drewinski: Die Globalisierung und der technische Fortschritt führen zu einer enormen Dynamik. Selbst kleinere Unternehmen verteilen heute ihre Fertigungs- oder sogar Entwicklungsstandorte international.
Diese Dynamik zeigt sich auch in der Produktentwicklung mit wechselnden organisatorischen Rahmenbedingungen
und Zielsetzungen. Ingenieure und Projektleiter benötigen hier verlässliche Daten und unterstützende Werkzeuge für die Zusammenarbeit. Für die Unternehmensführung sind wiederum Instrumente notwendig, die Transparenz
für die Betriebssteuerung schaffen und optimierte Prozesse ausführbar machen. Know-how, Kreativität und
Engagement der Ingenieure führen heute erst in Verbindung mit guten CAx- und PDM-Werkzeugen zu besseren
Ergebnissen.
Gibt es eine Grenze bei der Anzahl der Arbeitsplätze, unter der PDM keinen Sinn macht?
Roland Drewinski: PDM adressiert die Zusammenarbeit. Insofern ist natürlich der Nutzen umso höher, je wichtiger diese ist. Allerdings kann mit einer schlüsselfertigen, sprich Turnkey-Lösung beschränkt auf Kernfunktionen
schon in kleinen Teams mit weniger als 10 Mitarbeitern der Nutzen überwiegen. Hinzu kommen Vorteile für
das Unternehmen insgesamt, wenn wichtige Daten aus bislang persönlichen Ablagesystemen nun für alle
verfügbar sind. Oft ist auch die Anwenderzahl meist größer als anfangs gedacht, wenn nicht nur die Konstruktion,
sondern der Kreis der Mitarbeiter an einem Entwicklungsprojekt insgesamt berücksichtigt wird.
Kann ein PDM-Produkt helfen, die IT-Infrastruktur zu harmonisieren?
Roland Drewinski: Die Software-Vielfalt in den heutigen Unternehmen ist oft groß. Dabei beginnen dieProbleme meist dann, wenn sich niemand mehr mit den »unzusammenhängenden«, komplexen Programmskripten und Datenstrukturen auskennt oder die Daten zusammengeführt werden müssen. Ein PDM-System kann hier als Kristallisationspunkt für eine logisch zentrale und harmonisierte Lösung dienen. Voraussetzung ist, dass das benutzte PDM-System auch als Integrationsplattform ausgelegt ist.
Wie wichtig ist ein neutraler Berater bei der Systemauswahl?
Roland Drewinski: Da in der Gestaltungs- und Realisierungsphase die Kernkompetenz beim PDM-Anbieter
liegen muss, damit er für den Erfolg des eigenen Systems in Anspruch genommen werden kann,
helfen externe Berater oder Institute vor allem im ersten Schritt einer PDM-Einführung, wenn die Ziele
gesetzt werden und es im Unternehmen erst wenig PDM-Wissen gibt.
Sollte die PDM-Einführung eher von der Fachabteilung oder aber von der Unternehmensführung vorangetrieben
werden?
Roland Drewinski: Wenn der Nutzen sich nicht auf eine einzelne Abteilung beschränken soll, sind das Interesse und die verantwortliche Teilhabe der Unternehmensleitung unabdingbar. Ohne entsprechende Autorität können weiterreichende Entscheidungen gar nicht getroffen und mit Nachdruck umgesetzt werden. Ein typisches Beispiel sind Änderungen an der Nummerungssystematik, die weite Kreise ziehen kann. Kommen nun noch ein kooperativer Stil zwischen den Fachbereichen und das Engagement der Anwender für eine gute Lösung hinzu, ist die Ausgangssituation optimal.
Sollte bei der PDM-Einführung eher Schritt für Schritt vom »Kleinen ins Große« vorgegangen werden oder sollte gleich eine weitreichende »PDM-Strategie« realisiert werden?
Roland Drewinski: Als Faustregel kann man sagen: Strukturieren Sie das Roll-out in aufeinander aufbauenden Stufen. Verwenden Sie die Schwachstellenanalyse und konzentrieren Sie sich anfangs auf jene Themen, die das beste Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand versprechen. Darüber hinaus gilt: Je mehr ein Thema in die Organisation eingreift, desto wichtiger ist die Unterstützung durch die Unternehmensleitung. Die wichtigste Frage, der man sich gleich zu Beginn stellen sollte, ist: Inwieweit sollen die bisherigen Geschäftsprozesse und das formalisierte Wissen (»Orgware«) wie beispielsweise Nummerungssysteme oder Klassifikationsschemata
verändert werden, um die möglichen Vorteile eines IT-unterstützten PDM optimal zu nutzen?
Gibt es ein Standardrezept für die PDM-Systemauswahl?
Roland Drewinski: Typischerweise wird mit einer Marktbetrachtung begonnen, gefolgt von Präsentationen
und Referenzkundenbesuchen. Empfehlenswert ist auch, sich von einem Anbieter ein Grobkonzept erstellen zu lassen, um seine Arbeitsweise zu bewerten. Diesem wiederum bietet es Gelegenheit, sich detaillierter über die Anforderungen auszutauschen und die Realisierungsaufwände genauer abzuschätzen. Eine Teststellung kann abschließend letzte Fragen über Funktionalität, Bedienbarkeit und Konfigurierbarkeit eines Systems beantworten.
Gibt es das sprichwörtliche »Out-of-the-Box-PDM-Produkt«, das sich innerhalb weniger Tage produktiv schalten lässt?
Roland Drewinski: Ein PDM-Projekt ist immer auch ein Organisationsprojekt. Gute oder optimale Ergebnisse
erzielt man nur, indem Organisation und IT-System sinnvoll aufeinander abgebildet werden. Die in einem Out-of-the-Box-Produkt vorgegebenen Verfahren unterstützen dabei nicht zwangsläufig die gewachsenen Unternehmensprozesse. Ein Unternehmen wird also umso mehr von einer Standardlösung profitieren, je besser diese zum Unternehmen passt und je größer die Bereitschaft ist, sich vom Ist-Stand zu lösen.
Wie unterscheiden sich spezialisierte PDM-Anbieter und damit die Lösungen von solchen Software-Unternehmen, die auch CAD und mehr im Angebot haben?
Roland Drewinski: Ein CAD-Anbieter geht von seinem CAD-System aus und versucht dies gut zu unterstützen.
Der Schwerpunkt liegt dabei naturgemäß auf der CAD-Datenverwaltung. Reine PDM-Anbieter sehen ihre Stärken im MultiCAD-Daten-Management, bei der standortübergreifenden Nutzung und bei einem viel breiteren Produktdaten-Begriff. Hier gilt es also abzuwägen: Reicht ein auf ein CAD-System fokussiertes Daten-Management, und hebt sich diese Lösung in ihrem fokussierten Bereich durch klare funktionale Vorteile ab? Oder gehen die Anforderungen – auch perspektivisch betrachtet – darüber hinaus?
Welchen Anwendergruppen bringt PDM Vorteile?
Roland Drewinski: Eine PDM-Lösung sollte allen an der Produktentwicklung Beteiligten nützen. Sicherlich
liegt ein Anwendungsschwerpunkt unverändert in der Definition der Produktstruktur und -Geometrie für die Fertigung. Produktentwicklung beginnt aber vor der Konstruktion im CAD-System und hat viel mehr Facetten. Beispiele
sind die Erfassung und Bewertung von Produktanforderungen, ihre Bündelung zum Projekt- und Produktprogrammportfolio, die Angebotsunterstützung, Kostenkalkulation und Qualitätssicherung. Den Projektleitern sollte schließlich ein virtuelles Projektbüro und der Unternehmensführung eine Echtzeitübersicht über alle Leistungsindikatoren der Produktentwicklung zur Verfügung stehen.
Welche Rolle spielen im Mittelstand die Themen Collaboration und Projekt-Management?
Roland Drewinski: Gerade im Mittelstand ist ein hochdynamisches Projektumfeld an der Tagesordnung. Wie gesagt, geht es beim Thema PDM darum, die Zusammenarbeit zu unterstützen, wenn der Nutzen möglichst hoch sein soll. So sollte man auch das Thema Projekt-Management betrachten, bei dem es nur vordergründig um die Pflege des Terminplans geht. Tatsächlich geht es ja um die Frage, wie ein Team von Menschen im Rahmen eines Projektes
unter oft veränderlichen und nicht optimalen Randbedingungen ein Produkt entwickeln kann. Diese Sichtweise drückt sich in dem Begriff des Kollaborativen oder auch Kooperativen Projektmanagements aus.
Und welchen Beitrag leisten moderne PDM-Lösungen?
Roland Drewinski: Zeitgemäße PDM-Lösungen setzen hier mit einem – virtuellen – gemeinsamen Projektbüro
an, in dem alle Projektdaten, sämtliche Aufgaben und Arbeitsgegenstände in Echtzeit und an jedem Standort verfügbar sind. Dies sollte ergänzt werden durch eine Vorgangssteuerung. Letztlich dient das PDM-System als Leitstand der Produktentwicklung, in dem alle Parameter für jedermann einsehbar sind.
Was bedeuten die Faktoren »Skalierbarkeit « und »Flexibilität« im mittelständischen PDM-Umfeld?
Roland Drewinski: Ein Mittelständler will in absehbarer Zeit Resultate sehen. Sinnvollerweise wird man also überschaubar anfangen. Eine PDM-Lösung ist aber eine substantielle Investition, von der man über mindestens 5 Jahre hinweg profitieren möchte. Von daher ist die Entscheidung für einen bestimmten Anbieter auch immer eine Wette auf die Zukunft, in der sich das System veränderten Bedingungen anpassen muss. Dies betrifft vor allem die Anzahl der Anwender, die Ausweitung auf andere Standorte, funktionale Erweiterungen, andere oder zusätzlich
einzubindende CAD-Systeme und schließlich Veränderungen der bestehenden Lösung. Gerade weil das Umfeld sich heute schneller ändert als früher, muss ein System diese Flexibilität und Skalierbarkeit zu vertretbaren Kosten mitbringen. Dies wird leicht übersehen und sollte im Auswahlprozess, zum Beispiel bei Referenzkundenbesuchen, kritisch beleuchtet werden.
Herr Dr. Drewinski, durch Ihre Ausführungen haben Sie den Nutzen von PDM sehr sachlich dargestellt. Vielen Dank für das Gespräch. -mu-
eDM-REPORT
Publikationen: 4
Aufrufe seit 12/2006: 2826
Aufrufe letzte 30 Tage: 1